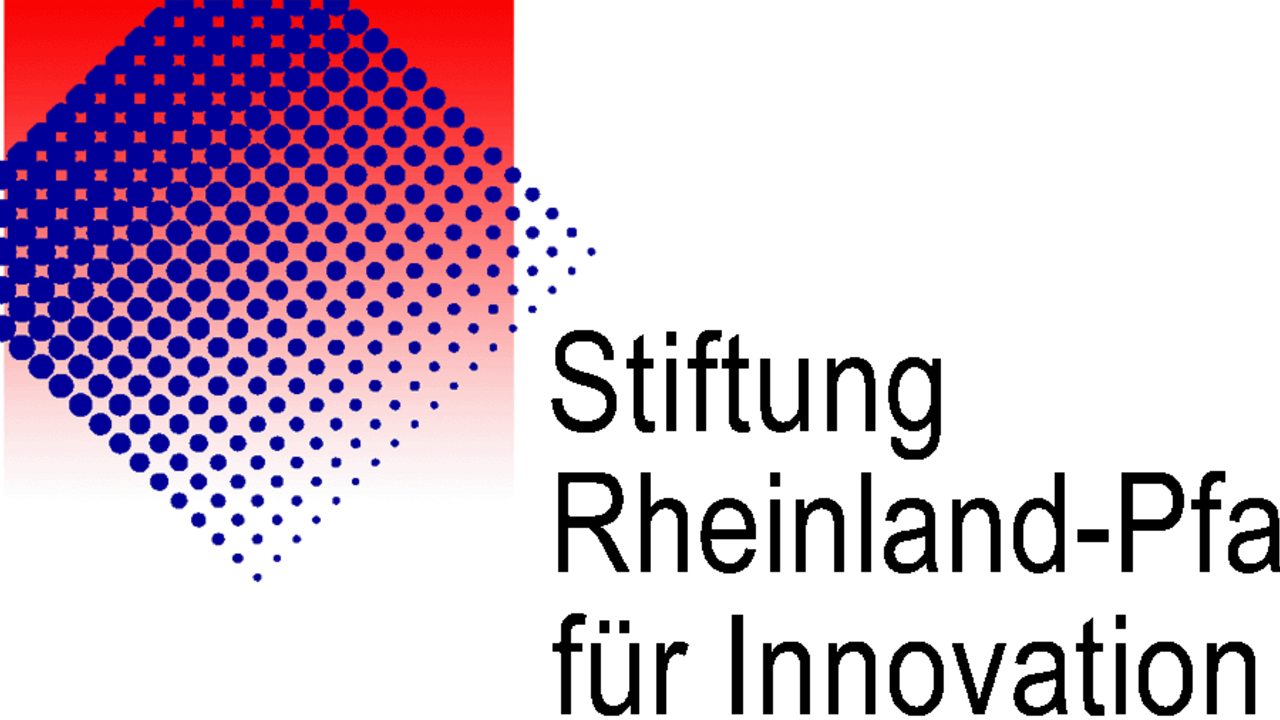Die Stiftung unterstützt Forschungsvorhaben von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes in ganz unterschiedlichen Gebieten. Diese reichen von der Medizin über die Material- und Werkstoffwissenschaften bis zur Informations- und Kommunikationstechnologie. Nicht selten werden in diesen Forschungsprojekten die Grundlagen gelegt, um die Wissenschaft noch enger mit der Wirtschaft zu verzahnen. Auch 2011 standen insbesondere naturwissenschaftlich-technische Forschungsprojekte an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie stark anwendungsbezogene medizinische Projekte im Fokus. Bei den meisten der neu aufgenommenen Projekte geht es um die Entwicklung neuer Technologien und Verfahren (50 Prozent) oder um den Transfer in die Praxis (37 Prozent).
Wie lebenswichtig Forschung sein kann, demonstrierte Prof. Lutz Achim Gäng, der an der Fachhochschule Kaiserslautern eine Halswirbelsäule für Crash-Test-Dummies entwickelt hat. Erste Untersuchungen zeigten, dass dieses Modell Unfall-Situationen wesentlich besser abbildet als bisherige Modelle. Ziel des Projektes war es, die als Unikat bestehende künstliche Halswirbelsäule in ein industrietaugliches Mess- und Entwicklungssystem zu überführen, welches den Einfluss von Muskeln, Bändern und Bandscheiben berücksichtigt und Bewegungen in verschiedene Richtungen ermöglicht. Zwei Lösungen zur Vermeidung bzw. Reduzierung des sogenannten „Schleudertraumas“ konnten bereits erarbeitet werden.
Praxisnah ist auch das zweite Projekt, das im Rahmen des Pressegesprächs vorgestellt wurde: An der Fachhochschule Koblenz widmet sich Prof. Georg Ankerhold dem Thema Materialanalyse. Bei der Stahlverarbeitung fallen in großem Maße metallhaltige Schlacken an. Um diese dem Recycling und der Wiedergewinnung wertvoller Legierungsmetalle zuführen zu können, bedarf es der genauen Materialanalyse vor Ort. Der Projektleiter entwickelt hierzu ein mobiles und handliches, laseroptisches System, welches einfach, schnell und ohne Probenvorbereitung präzise Messergebnisse liefern soll. Geplant ist der Einsatz für Oberflächen- und Tiefenprofilmessungen. Weitere Anwendungen, wie z. B. in der Zahnmedizin, sind denkbar.
„Die beiden Projekte veranschaulichen deutlich, worum es bei der Stiftungsförderung insgesamt geht: Im Zentrum steht die lebensnahe Forschung, die sich auch an praktischen Fragen unseres Alltags orientiert und an dem, was wir zu dessen Bewältigung brauchen“, so Ministerin Doris Ahnen. Entsprechend breit aufgestellt seien die Themen, denen sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den geförderten Projekten widmeten: Im vergangenen Jahr gehörte die Herstellung und Verträglichkeit von Wein ebenso dazu wie die Entwicklung neuartiger Antihaft-Oberflächen für Titanimplantate oder die Entwicklung von Leuchtdioden für Fahrzeuge. „Die Stiftung hat einen großen Anteil am Aufbau des Forschungsstandortes Rheinland-Pfalz sowie am Wissens- und Technologietransfer im Lande“, so Ahnen weiter. Positiv ausgewirkt habe sich dabei auch, dass es oft gerade junge Forscherinnen und Forscher seien, die von der Förderung profitierten und die sich bewusst dazu entschlössen, ihr Know-how an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen des Landes einzubringen.
Die Stiftungsförderung kann als Anschubfinanzierung wirken und dadurch zum Beispiel weitere Drittmitteleinwerbungen ermöglichen. So können auch Forschungsschwerpunkte aufgebaut und innovative Forschungsinstitute unterstützt werden. Neben der großen fachlichen Bandbreite, die die Stiftung fördert, konzentriert sie sich auf Schlüsseltechnologien an der Schnittstelle von Wissenschaft und Wirtschaft, die den spezifischen Kompetenzen der Forschungseinrichtungen entsprechen und das wirtschaftliche Potenzial des Landes reflektieren.
„Wissenschaft und Wirtschaft brauchen einander. Forschung ist Impulsgeber für Innovationen und deren Umsetzung ist Basis für wirtschaftliche Erfolge“, hob Eveline Lemke hervor. „Anwendungsorientierte Forschungsleistungen wie auch die Stiftung sie unterstützt, sind wichtig für einen effektiven Know-how-Transfer aus der Wissenschaft in die Wirtschaft. So werden hochqualifizierte und attraktive Arbeitsplätze in Rheinland-Pfalz gesichert“, so Lemke. Vielfach hätten Netzwerke oder Cluster auch von Stiftungsprojekten profitiert. Als Beispiel nannte sie Spitzencluster zu „Softwareinnovationen“ mit einer Transferstelle in Kaiserslautern oder zur „Immunintervention“ in Mainz - von Entwicklungen wie diesen profitiere die Wirtschaft nachhaltig.
Im Jahr 2011 hat die Stiftung 145 bereits laufende oder aber im vergangenen Jahr neu beantragte Projekte betreut. Der Schwerpunkt lag auf den technischen, anwendungsnahen Disziplinen. Bei den Fachrichtungen der neu aufgenommenen Projekte dominierte der Bereich Innovative Materialien und Oberflächentechnologie mit elf Projekten, die mit insgesamt 2,32 Millionen Euro gefördert wurden. Mikro- und Nanotechnologie sowie Simulation, Prozesssteuerung und Produktionsverfahren folgten mit jeweils sieben Projekten, gefördert mit 1,49 bzw. 1,43 Millionen Euro. Ebenfalls mehr als eine Million erhielt der Bereich Optische Technologien (sechs Projekte/ 1,26 Millionen Euro). Jeweils vier Förderungen konnten die Lebenswissenschaften Medizin/Medizintechnik (0,84 Millionen Euro) sowie Biotechnologie und Chemie (0,67 Millionen Euro) verbuchen, außerdem die Umwelt- und Energietechnologie (0,69 Millionen Euro).
Traditionell unterstützt die Stiftung auch den wissenschaftlichen Nachwuchs: So hat sie in 2011 diejenigen Schulen, die beim Landeswettbewerb „Jugend forscht“ erfolgreich waren, gefördert. Nicht zuletzt jene mit einer besonders hohen Quote von Nachwuchsforscherinnen.
Hintergrundinformationen zur Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation:
Die Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation wurde 1991 durch das Land Rheinland-Pfalz gegründet und mit einem Stiftungsvermögen von rund 100 Millionen Euro ausgestattet.
Erste Erlöse aus dem Stiftungskapital konnten 1993 für Fördermaßnahmen eingesetzt werden. Seitdem stehen jährlich rund fünf Millionen Euro zur Förderung der Grundlagenforschung, der anwendungsorientierten Forschung, des Einsatzes neuer Technologien und für den Transfer wissenschaftlicher Erkenntnisse in die Wirtschaft des Landes zur Verfügung.
Seit 1993 wurden 708 Forschungsprojekte mit rund 115 Millionen Euro unterstützt.
Alle Angelegenheiten der Stiftung von grundsätzlicher Bedeutung beschließt der Vorstand. Das Kuratorium berät den Vorstand in allen Fragen der Förderung von Innovation zur Verwirklichung des Stiftungszwecks. Dem Kuratorium gehören 15 Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik des Landes Rheinland-Pfalz an.
Die Geschäftsstelle unterstützt den Vorstand und das Kuratorium bei ihren Aufgaben und führt die laufenden Geschäfte der Stiftung.
Weitere Informationen zur Stiftung finden Sie unter:
<link http: external-link-new-window wird in einem neuen browserfenster ge>www.stiftung-innovation.rlp.de
|
Stiftung Rheinland-Pfalz für Innovation
Von der Wirbelsäule für den Crash-Test-Dummy bis zum cleveren Metall-Recycling
Mit Fördermitteln von rund 5,6 Millionen Euro hat die Stiftung „Rheinland-Pfalz für Innovation“ im vergangenen Jahr 30 neue Forschungsprojekte aus zukunftsorientierten Bereichen in die finanzielle Unterstützung aufgenommen. Damit konnte in 2011 das insgesamt 700. Projekt durch die Stiftung bewilligt werden. Dies hielten die Vorstandsvorsitzende der Stiftung, Wissenschaftsministerin Doris Ahnen, und die Kuratoriumsvorsitzende, Wirtschaftsministerin Eveline Lemke, heute bei der Jahresbilanz 2011 im Rahmen eines Pressegesprächs in Mainz fest.